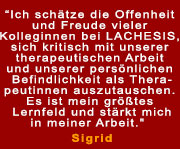Trauma, Posttraumatische Belastungsstörung und Traumatherapie
Autorin: Dr. med. Ingrid Olbricht
Ärztin für Psychotherapeutische Medizin, Neurologie und Psychiatrie, Gründungsmitglied von WAP und AKF
Leseprobe aus der LACHESIS Nr. 32
zum Thema "Trauma und Heilungswege"
Der Begriff "Trauma" wird derzeit inflationär benutzt, daher ist eine korrekte Definition und eine Unterscheidung zwischen Belastung, Stress und Trauma notwendig.
Traumaerfahrungen sind immer mit Ereignissen verbunden, die außerhalb des Rahmens normaler menschlicher Verarbeitungsmöglichkeiten liegen und die für jeden Menschen seelisch extrem belastend und qualvoll sind. Das Selbst wird überflutet von Reizen, Affektstürmen und Katastrophenerfahrungen. Durch ein Trauma wird die körperliche Unversehrtheit oder das Leben bedroht, die Betroffenen erleben sich als Opfer schrecklicher, unfassbarer Ereignisse, denen sie hilflos ausgeliefert sind. Handeln hat keinen Sinn mehr, weder Widerstand noch Flucht sind in traumatischen Situationen möglich. Das Selbstverteidigungssystem ist extrem überfordert, es kommt zum Zusammenbruch und zur temporären oder dauerhaften Zerstörung des komplexen Selbstschutzsystems.
Traumen können äußere Einwirkungen sein wie Naturkatastrophen oder Unfälle, zum Beispiel Bergwerksunfälle oder Verkehrsunfälle, Vulkanausbrüche, Überschwemmungen, Feuer, usw.. Sie können Begegnungen mit extremer Gewalt und Auslieferung darstellen, wie zum Beispiel bei Folteropfern, politischen Gefangenen, Soldaten mit besonders belastenden Kriegserlebnissen, Asylbewerbern, Geiseln und besonders bei Überlebenden von Konzentrationslagern. Sexuelle Misshandlung, wie bei der sexuellen Traumatisierung in der Kindheit oder bei der Vergewaltigung, verschlimmert die Auswirkungen der Traumatisierung. Eine andere Traumatisierungsmöglichkeit ist das Erleben extremer Defizite wie bei Verwahrlosung, frühen gewaltsamen Verlusten von Bezugspersonen und Heim- oder Gefängnisaufenthalte, Lager. Oft werden kombinierte Traumen erlebt, insbesondere auch bei der Traumatisierung von Kindern durch sexualisierte Gewalt.
Das Trauma gibt es nicht. Es gibt akute und chronische Gewalterfahrungen, seelische und körperliche Traumata, die jedoch meist kombiniert einwirken, es gibt direkte und indirekte Gewalt. Es gibt daher auch körperliche und seelische Folgen, sie können zeitnah sein oder als Spätfolgen auftreten und sind sehr unterschiedlich.
Das Ausmaß der akuten und chronischen Reaktionen wird mitbestimmt durch die Merkmale der traumatischen Situation, durch Schwere, Dauer und Häufigkeit des Traumas und des erlebten Kontrollverlustes sowie durch die vorher entwickelten Bewältigungskompetenzen, also von Alter und Entwicklungsstand des betroffenen Individuums und zusätzlich durch die Reaktionen des sozialen Umfeldes, das Ausmaß von Schutz, Verständnis und Unterstützung sowie eventuell dadurch, ob akut professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden konnte.
Die akute Stressreaktion als unmittelbare Traumafolge ist gekennzeichnet durch Übererregung mit innerer Unruhe, Aggressivität und Schlafstörungen, durch rekurrente intrusive Erinnerungen, tagsüber als Flash backs, nachts als Alpträume sowie als Vermeidungsverhalten nach innen und außen. Die akute Reaktion ist praktisch bei allen Traumabetroffenen zu beobachten, sie nimmt üblicherweise im Lauf von Wochen bis Monaten ab. Wenn sie sich zu irgendeinem Zeitpunkt wieder verstärkt und intensiviert, sprechen wir von einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), die behandlungsbedürftig ist.
Sie kann zum Auslöser für schwere Entwicklungsstörungen werden. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine PTBS entwickelt wird und anhält, höher, wenn das Trauma auf das Handeln von Menschen zurückgeht, wenn es auf eine Persönlichkeit trifft, deren Bewältigungskompetenzen nicht ausreichend entwickelt sind, wenn es lange andauert oder sich häufig wiederholt, wenn moralische Konflikte und Tabus eine Rolle spielen und wenn das soziale Umfeld die Traumatisierung ignoriert bzw. das Opfer für die erlittenen Erfahrungen entwertet.
Traumatisierte nehmen Reize anders auf, sie ordnen anders zu als Personen ohne Traumaerfahrungen. Hier scheinen - bei aller Komplexität der Strukturen und der Interaktionen insbesondere zwei Hirnstrukturen eine besondere Rolle zu spielen. Das biographische Gedächtnissystem des Hippokampus speichert episodisch, mit moderaten Gefühlsqualitäten, es zeichnet Informationen neutral und kontrolliert auf, integriert und ordnet räumlich und zeitlich zu, so dass keine Gefahr besteht, dass Gedächtnisinhalte für gegenwärtige Wahrnehmungen gehalten werden. Die Erinnerungen werden als Wortrepräsentanz kodiert, die Erinnerungen können also ohne weiteres in Worte gefasst und geschildert werden. Es gibt Verbindungen zu beiden Hemisphären, zum Sprachzentrum und zu anderen Hirnbereichen. Dieses Gedächtnis entwickelt sich etwa ab dem 4. - 12. Lebensjahr, Ereignisse vor der Entwicklung des Hippokampus, also in der frühesten Kindheit, können wir sprachlich nur bruchstückhaft ausdrücken.
Dieses "Archiv" schaltet aber beim Erreichen eines bestimmten Reizpegels ab. Wenn der Stress zu groß wird, wird dadurch das Selbst geschützt. Dann übernimmt die Amygdala, der Mandelkern, der in jeder Gehirnhälfte seitlich des Temporallappens liegt, die Speicherung. Die Amygdala speichert direkt, ohne Einschaltung der Hirnrinde, sie speichert fragmentarisch im Hier-und-Jetzt-Erleben, sie speichert überwiegend Sinneseindrücke, also sensorische Merkmale wie Bilder, Geräusche, Gerüche, Körpergefühle, Affekte und begleitende Emotionen. Erinnerungen werden als Gefühlsrepräsentanzen kodiert und sind damit verbal nur schwer zugänglich, zumal kaum Verbindungen zu anderen Hirnanteilen bestehen. Das erklärt auch das Nicht-verbalisieren-können oder die Schilderung von traumatischen Ereignissen mit den immer gleichen, fast stereotypen Worten und Sätzen. Dieses Gedächtnis ist ab der Geburt und vielleicht bereits vor der Geburt aktiv. Die hier gespeicherten Erinnerungen sind nicht zugänglich, nur triggerbar. Das heißt, dass bei bestimmten Gefühlsqualitäten die Amygdala "anspringt" diese Erinnerungen aber nicht in einen biographischen Kontext einbettet. Sie arbeitet dissoziativ, d.h. sie kennt keine Verknüpfung mit anderen Ereignissen und damit auch keine Vergangenheit. Die Amygdala wird am stärksten aktiviert durch Angst, Furcht, Schrecken. Damit ist sie auch für das emotionale und soziale Verhalten des Menschen bedeutsam. Ob eine Erfahrung ein Trauma ist oder nicht, zeigt sich darin, wo das Erlebnis gespeichert wurde. Ein Trauma ist nur diejenige Erfahrung, die dissoziiert gespeichert und damit nicht in allen Qualitäten zugänglich ist. Ein "bisschen traumatisiert" gibt es daher nicht. Die hirnbiologischen und hirnstrukturellen Besonderheiten müssen daher sowohl bei der Anamneseerhebung als auch insbesondere bei jeder Traumatherapie berücksichtigt und einbezogen werden.
Die Traumafolgen sind altersabhängig. So finden wir bei Kindern bis zu drei Jahren nach sexualisierter Gewalterfahrung relativ unspezifische Zeichen wie Angst und Verwirrung, Schlaf- und Essstörungen und deutlichen Entwicklungsstörungen.
Im Vorschulalter werden Angst und Verwirrung und bereits Scham- und Schuldgefühle sowie eine Zunahme der Aggressivität beobachtet, ebenso ein Gefühl von Schutz- und Hilflosigkeit. Das äußert sich in regressiven Verhaltensweisen, eventuell wieder auftretendem Einnässen oder Einkoten, Daumenlutschen, Unruhe, Jucken der Scheide und Masturbieren, Essstörungen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Schlafstörungen und Alpträumen.
Zwischen dem sechsten und neunten Lebensjahr können Misstrauen und Zwangshandlungen wie Waschzwang oder exzessives Baden dazukommen, gelegentlich schon Suizidalität, soziale Probleme im Umgang mit Gleichaltrigen, aggressives oder sexualisiertes provozierendes Verhalten, sozialer Rückzug, Beziehungsprobleme und Schulversagen.
Zwischen dem neunten bis dreizehnten Lebensjahr treten zusätzlich bereits Depressionen auf, Selbstwert- und Identitätsprobleme, Probleme mit dem Rollenverhalten, Selbstverletzungen, die Suizidalität wird deutlicher und konkreter, die sozialen Probleme ausgeprägter, Schuleschwänzen, Rauchen, Alkohol- und Drogenkonsum, promiskuöses Verhalten sowie sozialer Rückzug. Wenn Kinder nach Gewalterfahrungen auffällig und schwierig werden, können sie dadurch zusätzliche Probleme haben.
In der Adoleszenz schließlich wird das aggressive und autoaggressive Verhalten noch deutlicher, zu den bereits bekannten und sich immer deutlicher ausprägenden Symptomen können manifeste Essstörungen im Sinne von Anorexie und Bulimie kommen, Verwahrlosung, Promiskuität, verschiedene Abhängigkeitserkrankungen, Jugendkriminalität sowie erhebliche Beziehungs- und Entwicklungsstörungen. Zusätzlich zu dieser eher diffusen Symptomatik können sich eigenständige Krankheitsbilder wie die Posttraumatische Belastungsstörung, Dissoziative Identitätsstörungen oder Psychosen ausbilden.
Insgesamt fällt auf, dass alle Störungen sehr viel früher in der Entwicklung auftreten können als sie üblicherweise altersmäßig bekannt sind.
(...)
(Ende der Leseprobe)
Haben wir Ihr Interesse für die Zeitschrift Nr. 32 geweckt?